 8 th European HIV Drug Resistance Workshop
8 th European HIV Drug Resistance Workshop
Neue Erkenntnisse zur Resistenz
Zu dem im Vergleich zu anderen Kongressen überschaubaren achten Europäischen Resistenzworkshop waren 306 Teilnehmer angereist. 103 Abstracts wurden als Poster vorgestellt, 32 davon auch als Vortrag.
Die erste Session beschäftigte sich mit dem Therapie-Management bei Patienten mit niedriger oder nicht nachweisbarer Viruslast. Anna Maria Geretti (Royal Free Hospital, London) stellte in ihrem Übersichtsvortrag die Problematik der Therapieumstellung trotz erfolgreicher Therapie dar. Selbst in der Firstline HAART kam sie bei einer Analyse ihrer Kohorten zu einem Anteil von 23% der Patienten, bei denen vor Erreichen einer Viruslast unter der Nachweisgrenze die Therapie umgestellt werden musste. Der Hauptgrund für die Therapieumstellung war mit 51% Anteil eine Unverträglichkeit der ersten Therapiekombination. Eine nicht ausreichende virologische Aktivität war in 30% der Fälle der Grund für eine Umstellung. Aus der vorhergehenden Therapie kann zwar eine Abschätzung der potentiellen Resistenzlage erfolgen, bei mehrfach vorbehandelten Patienten wird dies jedoch deutlich komplexer, wie sich unter anderem aus den Ergebnissen der SWITCHMRK-Studien 1 und 2 ablesen lässt.
Resistenztest bei niedriger Viruslast
Bei Therapieversagen sollte vor der Umstellung ein Resistenztest durchgeführt werden. Theresa Pattery (Mechelen, Belgien) vom Unternehmen Virco stellte Daten zur Zuverlässigkeit von genotypischen Resistenztests bei Viruslasten unter 1.000 Kopien/ml dar (#1 Pattery T et al.). Während bei Viruslasten zwischen 500 und 1.000 Kopien/ml ca. 75% der Untersuchungen erfolgreich waren, nimmt diese Rate unter 500 Kopien/ml deutlich ab. Als Schlussfolgerung wird der Resistenztest unter 500 Kopien/ml nicht empfohlen. Dem widersprach Andrea de Luca (Università Cattolica del Sacro Cuore, Rom, Italien) in einer darauf folgenden Fallvorstellung. Auch bei geringen Viruslasten unter 500 Kopien/ml könne ein erfolgreich durchgeführter Resistenztest wertvolle Zusatzinformationen liefern. Die Interpretation der Ergebnisse sollte aber entsprechend vorsichtig vorgenommen werden. Resistenz-assoziierte Mutationen, die bei einem folgenden Therapieversagen vorhanden sind, können zum derzeitigen Zeitpunkt möglicherweise noch nicht nachgewiesen werden. Die Häufigkeit des Nachweises Resistenz-assoziierter Mutationen ist in einem Viruslastbereich zwischen 1.000 und 100.000 Kopien/ml am höchsten. Bei sehr hohen Viruslasten handelt es sich meist um ein Compliance-Problem, mit einer Resistenz gegen die Medikamente ist somit aufgrund fehlenden Selektionsdrucks nicht zu rechnen. Im Gegensatz dazu ist bei niedrigen Viruslasten die Resistenz häufig noch nicht ausreichend ausgeprägt (#67 Prosperi et al.).

Abb. 1: Neue und bekannte NNRTI-Mutationen
Neue Generation von NNRTI
Die zweite Session begann mit einem Übersichtsvortrag von Carlo Frederico Perno (Universität Rom „Tor Vergata“, Italien) zum Stellenwert der NNRTI und insbesondere zur Bedeutung der NNRTI der zweiten Generation bei bestehenden Mutationen gegen die Erstgenerations-NNRTI. So sollte eine versagende Therapie bei einem NNRTI der ersten Generation möglichst schnell beendet werden um das Akkumulieren von zusätzlichen Mutationen zu verhindern. Diese Mutationen (z.B. G190A), die nach den Hauptmutationen K103N und Y181C auftreten, können die Wirksamkeit der Zweitgenerations-NNRTI einschränken. Margriet van Houtte (Virco, Mechelen, Belgien) stellte neue Mutationen vor, die das Ansprechen auf NNRTI beeinflussen (#2 van Houtte M et al). Die Mutationen 102L, 138Q, 139R, 179L, 179Y, 181F und 221L werden zwar selten gefunden, haben aber deutliche Auswirkungen auf die phänotypisch gemessenen Resistenzfaktoren (Abb. 1).
Der Maturationsinhibitor Bevirimat hat wahrscheinlich keine große Zukunft. Dennoch sind Daten über die Resistenzmechanismen für Folgesubstanzen unerlässlich. Die mit einem Vortragspreis ausgezeichnete Präsentation von Axel Fun (Universität Utrecht, Holland) zeigte den Zusammenhang von Resistenz-assoziierten Mutationen im Bereich der Protease mit den kompensatorischen Mutationen im gag-Schnittstellenbereich und den daraus resultierenden Einfluss auf die Wirksamkeit von Bevirimat (#3 Fun A et al). So entstehen unter zusätzlichem Selektionsdruck durch Proteaseinhibitoren in der Zellkultur andere Resistenz-kodierende Mutationen als bei Selektion nach entsprechenden Mutationen mit Bevirimat alleine. Folgesubstanzen sollten diese Mutationen mit einplanen.
Entry Inhibitoren

Das Land der Zitronen
Der nächste Block befasste sich mit den Entry-Inhibitoren. Richard Harrigan (British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS, Vancouver, Canada) zeigte in seinem Übersichtsvortrag nochmals die Gleichwertigkeit von genotypischer und phänotypischer Tropismusbestimmung. Klinische Daten zur Korrelation von Tropismusbestimmung und Therapieverlauf wurden von mehreren Gruppen präsentiert. Die Entscheidung für eine Maraviroc-haltige Therapie basierend auf der genotypischen Tropismusbestimmung war sehr erfolgreich und zeigte eine hohe Sicherheit auch bei Verwendung eines Tropismustests aus proviraler DNA (#20 Sierra S. et al., Universität Köln, Deutschland; #23 Obermeier M et al.). Resistenzen von CCR5-tropen Viren gegen Maraviroc bleiben selten und sind bisher kaum bei therapienaiven Patienten zu beobachten (#19 Seclén E. et al., Hospital Carlos III., Madrid, Spain). Ultra-deep sequencing gewinnt einen immer höheren Stellenwert bei der Analyse der im Patienten vorliegenden Virusvarianten. Dieser Einblick in die individuelle Zusammensetzung der patientenspezifischen Viruspopulation kann auch einen geringen Anteil an CXCR4-tropen Viren nachweisen (#25 Däumer M et al., Institut für Immunologie und Genetik, Kaiserslautern, Deutschland; #39 van‘t Wout A.B. et al., Universität von Amsterdam, Holland). Hier bleibt aber weiterhin die Frage offen, ab welchem Anteil eine minore Population relevant ist (#22 Garcia F. et al., Clinico San Cecilio, Granada, Spanien). Eine Verbesserung der genotypischen Vorhersage durch Einsatz von gp41-Sequenzen ist nur gering (#49 Thielen A et al., MPI Saarbrücken, Deutschland).
Intergrase-Inhibitoren

Blick auf Sorrent und Vesuv
Bei den Integrase-Inhibitoren wurden vor allem die Daten zu S/GSK 1349572 mit großem Interesse aufgenommen. Die Daten sprechen für geringe Kreuzresistenz und eine hohe genetische Barriere, wobei diese Erkenntnisse durch in vitro-Experimente gewonnen und bisher nicht durch in vivo-Daten bestätigt wurden (#29 Sato A. et al., Shionogi & Co. Ltd., Osaka, Japan; #31 Kobayashi M. et al., Shionogi & Co. Ltd., Osaka, Japan).
Raltegravir scheint auch beim Nachweis der typischen Resistenz-assoziierten Mutationen eine residuelle Aktivität zu besitzen (#34 Fun A. et al., Universität Utrecht, Holland). Diese Tatsache könnte durchaus für Recycling-Strategien eine gewisse Relevanz besitzen.
Algorithmen
Resistenz bei Hepatitis B
Mit der zunehmenden Verwendung von antiviral aktiven Medikamenten bei anderen Viren befasste sich eine eigene Session. Für HBV wurden Interpretationstools (#9 Beggel B. et al., MPI Saarbrücken, Deutschland) und die Auswirkung von Resistenz-assoziierten Mutationen auf die immunologische Erkennung von HBs-Antigen (#8 Fraune M. et al., Universität Köln, Deutschland) vorgestellt.
Bioinformatische Systeme können inzwischen die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Therapie besser vorhersagen als Experten. Das EuResist-Experten System jedenfalls scheint erfolgreicher zu sein als weltweit befragte menschliche Experten (Zazzi M et al. #45, Universität von Siena, Italien). Neben „Comet“, einem neuen sehr schnellen Werkzeug zur Subtypen-Analyse (#88 Struck D et al., CRP-Santé, Luxemburg), wurden in dem abschließenden Block auch Daten zur Raltegravir-Resistenz gegen HIV-2 gezeigt. Hier scheinen neben der auch bei HIV-1 relevanten Mutation N155H die Mutation S163D eine wichtige Rolle zu spielen (#101 Garrido Pavon, C., Hospital Carlos III., Madrid, Spanien).
In den Entwicklungsländern spielt die vertikale Transmission von HIV eine sehr wichtige Rolle. Auch hier zeigt sich eine effektive HAART der Mutter erfolgreich und reduziert die Übertragung von resistenten Viren auf das Kind (#53 Karasi J.C. et al., CRP-Santé, Luxemburg).
Nach zweieinhalb Tagen ging ein sehr spannender Kongress zu Ende. Ob die Relevanz der Testung auf Resistenz-assoziierte Mutationen in Zeiten effektiverer und unkomplizierter Therapien abnimmt, blieb trotz ausführlicher Diskussion in vielen Sessions ungeklärt.





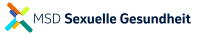





 Diese Seite weiter empfehlen
Diese Seite weiter empfehlen
