Gefährden HIV-Schwerpunktärzte die Kollegen?
Die HIV-Schwerpunktärztin Dr. Gaby Knecht, Frankfurt, überwies eine Patientin zur intravenösen Infusion am Wochenende zum ärztlichen Notdienst. Auf dem Überweisungsschein war die HIV-Diagnose als "B24" vermerkt. Der behandelnde Kollege fühlte sich lebensbedrohlich gefährdet und wollte bei der Ärztekammer Beschwerde einlegen. HIV&more fragte Experten und Vertreter von Gesellschaften nach ihrer Meinung. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin und die Deutsche für Chirurgie zeigten erstaunlicherweise kein Interesse an dem Thema und lehnten einen Kommentar ab.
Die Ende 50jährige Patientin stellte sich am Samstag und Sonntag im allgemeinen hausärztlichen Vertretungsdienst zur intravenösen Infusion eines Antibiotikums vor. Auf dem Überweisungsschein an den "ärztlichen Notdienst" stand "Urosepsis bei B24. Erbitte Infusion Tavanic". Am zweiten Behandlungstag teilte die Patienten dem Kollegen im ärztlichen Notdienst auf Nachfragen mit, dass sie HIV-positiv ist. Dieser ist geschockt und beschuldigt die Patientin als "Verbrecherin", da sie nicht gleich ihren HIV-Status offen legte. Bei der Patientin, die - so der Kollege - "augenscheinlich nicht zu einer Risikogruppe gehörte", konnten deshalb bei den vorigen Infusionen "keine über das übliche Maß hinausgehenden Schutzmaßnahmen ergriffen werden". Hierdurch sei eine "akute Gefährdung" von Ärzten und Personals entstanden, denn schließlich "geht von der HIV-Infektion eine potentielle Lebensgefahr aus" und auch wenn stets besondere Sorgfalt mit Blut und Blutprodukten geboten sei, "ändere sich das Verhalten der Mitarbeiter bei bekannter und konkreter Gefahr durch das HI-Virus erheblich". Die Kennzeichnung der HIV-Positivität durch ein leicht zu überlesendes, verschlüsseltes B24 in einem langen Überweisungstext ist nach Meinung des Kollegen zur sicheren Diagnoseübermittlung nicht ausreichend. Von der Weitergabe solch "lebenswichtiger" Informationen müsse sich der Überweiser, insbesondere eine spezialisierte HIV-Praxis, nötigenfalls persönlich überzeugen. RPV
Kommentar Dr. StefanTimmermans, Referent für Menschen mit HIV und Aids der Deutschen AIDS-Hilfe, Berlin:
 Die
Reaktion des Gynäkologen Dr. G. H. macht in erschreckender Weise deutlich, dass irrationale Ängste,
Vorurteile und Unwissenheit auch bei medizinischem Fachpersonal in Deutschland immer noch vorhanden sind
und an der Qualität der Behandlung von Menschen mit HIV und Aids im medizinischen Bereich gearbeitet
werden muss. Das Beispiel aus Frankfurt zeigt, dass Menschen mit HIV/Aids in Deutschland immer noch
stigmatisiert sind. In einigen Köpfen besteht immer noch das Vorurteil, Aids betreffe nur bestimmte "Randgruppen"
in unserer Gesellschaft. Zudem scheint es Ärzte zu geben, die davon überzeugt sind, dass man es
einem Menschen ansieht, ob er Drogen gebraucht oder als Mann Sex mit Männern hat. Wenn medizinisches
Personal Angst hat, sich bei der Verabreichung einer Infusion an eine HIV-positive Person anzustecken,
muss jedoch entweder Unwissenheit über die Ansteckungswege von HIV vermutet werden oder es ist
irrationale Panikmache am Werk. Egal aus welcher Perspektive man den Vorfall betrachtet: Aufklärung
in vielerlei Hinsicht scheint dringend nötig! Nicht allen Menschen steht ihre sexuelle Orientierung
oder ihr Drogenkonsum ins Gesicht geschrieben. Aids ist in Deutschland schon seit geraumer Zeit in der
Mitte der Gesellschaft angekommen: Auch Heterosexuelle und Nicht-Drogenkonsumierende können sich
infizieren. Die Deutsche AIDS-Hilfe hat im Gegensatz zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) die zielgruppenspezifische Prävention zur Aufgabe. Vielleicht sollte überlegt werden, ob
das Spektrum nicht um die Gruppe des medizinischen Personals erweitert werden muss. In Analogie zum
allseits bekannten Slogan der BZgA könnte hier folgende Botschaft formuliert werden: Latexhandschuhe
schützen! Mach's mit!
Die
Reaktion des Gynäkologen Dr. G. H. macht in erschreckender Weise deutlich, dass irrationale Ängste,
Vorurteile und Unwissenheit auch bei medizinischem Fachpersonal in Deutschland immer noch vorhanden sind
und an der Qualität der Behandlung von Menschen mit HIV und Aids im medizinischen Bereich gearbeitet
werden muss. Das Beispiel aus Frankfurt zeigt, dass Menschen mit HIV/Aids in Deutschland immer noch
stigmatisiert sind. In einigen Köpfen besteht immer noch das Vorurteil, Aids betreffe nur bestimmte "Randgruppen"
in unserer Gesellschaft. Zudem scheint es Ärzte zu geben, die davon überzeugt sind, dass man es
einem Menschen ansieht, ob er Drogen gebraucht oder als Mann Sex mit Männern hat. Wenn medizinisches
Personal Angst hat, sich bei der Verabreichung einer Infusion an eine HIV-positive Person anzustecken,
muss jedoch entweder Unwissenheit über die Ansteckungswege von HIV vermutet werden oder es ist
irrationale Panikmache am Werk. Egal aus welcher Perspektive man den Vorfall betrachtet: Aufklärung
in vielerlei Hinsicht scheint dringend nötig! Nicht allen Menschen steht ihre sexuelle Orientierung
oder ihr Drogenkonsum ins Gesicht geschrieben. Aids ist in Deutschland schon seit geraumer Zeit in der
Mitte der Gesellschaft angekommen: Auch Heterosexuelle und Nicht-Drogenkonsumierende können sich
infizieren. Die Deutsche AIDS-Hilfe hat im Gegensatz zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) die zielgruppenspezifische Prävention zur Aufgabe. Vielleicht sollte überlegt werden, ob
das Spektrum nicht um die Gruppe des medizinischen Personals erweitert werden muss. In Analogie zum
allseits bekannten Slogan der BZgA könnte hier folgende Botschaft formuliert werden: Latexhandschuhe
schützen! Mach's mit!
Kommentar Rechtsanwalt Jacob Hösl, Köln:
Von solchen und ähnlich gelagerten Fällen höre ich in meiner Praxis immer wieder. Die Berufsordnungen des Bundes und der Länder der Ärzte schreiben ausdrücklich vor, dass die Schweigepflicht auch zwischen Überweisendem und Überweisungsarzt gilt und einzuhalten ist. Für HIV gelten keine Ausnahmeregelungen. Die HIV-Infektion eines Patienten ist demnach grundsätzlich bei einer Überweisung nach den berufsrechtlichen Regelungen gar nicht anzugeben. Nur, wenn die konsiliarische Behandlung einen Zusammenhang mit der Grunderkrankung hat, ist die Weitergabe der hierzu erforderlichen Daten indiziert. Hierüber entscheidet der überweisende Arzt, denn nur er wird ggf. wegen einer Schweigepflichtsverletzung zur Verantwortung gezogen.
Des Weiteren schreibt die Berufsordnung vor, dass Ärzte sich über ihr Fachgebiet hinaus über allgemeine Fragen ihres Berufs zu unterrichten und ggf. fortzubilden haben. Ärzte, die (insbesondere erstmals) mit einem Patienten zu tun haben, müssen sich immer so verhalten, als bestünde eine Infektionsgefahr, egal welcher Natur. Es scheint hier aber so, dass der Arzt im Notdienst die Schutz- und Hygienevorschriften nicht (vollständig) einzuhalten pflegt, denn die Formulierung "keine über das übliche Maß hinausgehenden Schutzmaßnahmen ergriffen werden" kann nur so interpretiert werden, dass das "übliche Maß" das Nicht-ganz-Einhalten der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen bedeutet, ansonsten hätte eine Infektionsgefahr ja nicht bestanden. Das erklärt auch seinen die verbalen Verfehlungen begründenden Schreck über diese ganze Sache. Einen Patienten als "Verbrecher" zu bezeichnen, ist indiskutabel.
Kommentar Prof. Dr. Jürgen Rockstroh, Präsident der Deutschen AIDS Gesellschaft (DAIG):
 Grundsätzlich
ist darauf hinzuweisen, dass in Westeuropa von den Menschen, die mit HIV leben, gut ein Drittel die
Diagnose nicht kennt. Damit ist bei jedem Patienten, bei dem eine Venenpunktion vorgenommen wird, grundsätzlich
auch eine mögliche HIV-Infektion nicht auszuschließen und es sind entsprechende Schutzmaßnahmen
vorzunehmen. Diese Schutzmaßnahmen vor der Transmission einer Hepatitis- oder HIV-Infektion durch
eine mögliche Nadelstichverletzung sind unabhängig von der Diagnose eines Patienten anzuwenden.
Grundsätzlich
ist darauf hinzuweisen, dass in Westeuropa von den Menschen, die mit HIV leben, gut ein Drittel die
Diagnose nicht kennt. Damit ist bei jedem Patienten, bei dem eine Venenpunktion vorgenommen wird, grundsätzlich
auch eine mögliche HIV-Infektion nicht auszuschließen und es sind entsprechende Schutzmaßnahmen
vorzunehmen. Diese Schutzmaßnahmen vor der Transmission einer Hepatitis- oder HIV-Infektion durch
eine mögliche Nadelstichverletzung sind unabhängig von der Diagnose eines Patienten anzuwenden.
Die hier geschilderte Situation als "lebensbedrohliche Gefährdung" einzustufen, erscheint deutlich übertrieben; vielmehr ist sie imminent mit der Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit verknüpft. Anzumerken ist allerdings, dass insbesondere bei Kollegen mit geringer HIV-Erfahrung und -Exposition die Kenntnis der Diagnose zu einem angstfreieren Umgang mit dem Patienten führen kann. Leider gibt es allerdings hierfür auch zahlreiche Gegenbeispiele, die mit einer vermehrten Stigmatisierung und Diskriminierung von Patienten enden.
Kommentar Dr. Thomas Lutz, Vorstand der Hessischen Arbeitsgemeinschaft von HIV-Versorgern (HIVAG):
 Das
diskriminierende Verhalten des im ärztlichen Notdienst tätigen Kollegen gegenüber einer
sich ihm anvertrauenden Patientin ist erschütternd, doch leider kein Einzelfall. Bedauerlich
ebenfalls die in diesem Fall mangelnde Einsicht des Kollegen, die Ereignisse in einem unter Leitung der Ärztekammer
mit dem HIVAG-Vorstand geführten Gespräch mit Abstand neu zu bewerten. Es ist für den
Infektiologen immer wieder überraschend, wie eklatant gelegentlich der Wissensmangel bezüglich
des beruflichen Transmissionsrisikos von HIV und anderer chronischer Virusinfektionen (HBV, HCV) auch im
Kollegenkreis ist und welche Ängste daraus in der Patientenbetreuung resultieren. Dem kann nur
begegnet werden, indem weiterhin unbeirrt in Kooperation mit den regionalen KVen, den Ärztekammern
und AIDS-Hilfen durch Fortbildungen und Informationsveranstaltungen zumindest die interessierten Kollegen
informiert werden. Die ebenfalls strittige Frage der Diagnosemitteilung einer HIV-Infektion an
mitbehandelnde Kollegen (z.B. auf dem Überweisungsschein) ist aus Sicht der HIVAG unbedingt sinnvoll.
Dies hat in beschriebenen Fall sowohl durch die behandelnde Ärztin als auch durch die Patientin
selbst stattgefunden. Hintergrund ist jedoch keineswegs ein vermeintliches Infektionsrisiko für den
weiterbehandelnden Arzt. Dieses ist in den allermeisten konsiliarischen Untersuchungen und medizinischen
Prozeduren (spezielle chirurgische Interventionen vielleicht ausgenommen) bei Einhaltung der ohnehin
empfohlenen und generell gültigen Schutzmaßnahmen nahezu ausgeschlossen. In erster Linie ermöglicht
die Kenntnis einer HIV-Diagnose dem mitbehandelnden Kollegen - auch zum Wohle des Patienten - die richtige
Interpretation von Untersuchungsbefunden oder auch die Einschätzung von potentiellen Wechselwirkungen
einer medikamentösen Therapie mit der ggf. eingenommenen HAART. Für diese Haltung bei den
betreuten Patienten zu werben, ist eine der zeitintensiven Aufgaben in der HIV-Behandlung.
Bedauerlicherweise konterkarieren diskriminierende Reaktionen selbst von medizinischem Personal diese Bemühungen
und könnten - vermutlich ungewollt - zu der gegenteiligen, aber verständlichen Reaktion des
Schweigens bei Patienten führen. Damit wäre keinem der Beteiligten gedient. Zu der abschließenden
juristischen Einschätzung, ob die Diagnose einer HIV-Infektion - wie von mancher Seite durchaus
gefordert - nun auf einem Überweisungsschein durch den Behandler verpflichtend zu erfolgen hat und in
welcher Form dies geschehen sollte (ICD-Code oder ausgeschrieben), steht in Hessen die Stellungnahme der
Justitiare aus. Diese wird auch Patientenrechte berücksichtigen müssen.
Das
diskriminierende Verhalten des im ärztlichen Notdienst tätigen Kollegen gegenüber einer
sich ihm anvertrauenden Patientin ist erschütternd, doch leider kein Einzelfall. Bedauerlich
ebenfalls die in diesem Fall mangelnde Einsicht des Kollegen, die Ereignisse in einem unter Leitung der Ärztekammer
mit dem HIVAG-Vorstand geführten Gespräch mit Abstand neu zu bewerten. Es ist für den
Infektiologen immer wieder überraschend, wie eklatant gelegentlich der Wissensmangel bezüglich
des beruflichen Transmissionsrisikos von HIV und anderer chronischer Virusinfektionen (HBV, HCV) auch im
Kollegenkreis ist und welche Ängste daraus in der Patientenbetreuung resultieren. Dem kann nur
begegnet werden, indem weiterhin unbeirrt in Kooperation mit den regionalen KVen, den Ärztekammern
und AIDS-Hilfen durch Fortbildungen und Informationsveranstaltungen zumindest die interessierten Kollegen
informiert werden. Die ebenfalls strittige Frage der Diagnosemitteilung einer HIV-Infektion an
mitbehandelnde Kollegen (z.B. auf dem Überweisungsschein) ist aus Sicht der HIVAG unbedingt sinnvoll.
Dies hat in beschriebenen Fall sowohl durch die behandelnde Ärztin als auch durch die Patientin
selbst stattgefunden. Hintergrund ist jedoch keineswegs ein vermeintliches Infektionsrisiko für den
weiterbehandelnden Arzt. Dieses ist in den allermeisten konsiliarischen Untersuchungen und medizinischen
Prozeduren (spezielle chirurgische Interventionen vielleicht ausgenommen) bei Einhaltung der ohnehin
empfohlenen und generell gültigen Schutzmaßnahmen nahezu ausgeschlossen. In erster Linie ermöglicht
die Kenntnis einer HIV-Diagnose dem mitbehandelnden Kollegen - auch zum Wohle des Patienten - die richtige
Interpretation von Untersuchungsbefunden oder auch die Einschätzung von potentiellen Wechselwirkungen
einer medikamentösen Therapie mit der ggf. eingenommenen HAART. Für diese Haltung bei den
betreuten Patienten zu werben, ist eine der zeitintensiven Aufgaben in der HIV-Behandlung.
Bedauerlicherweise konterkarieren diskriminierende Reaktionen selbst von medizinischem Personal diese Bemühungen
und könnten - vermutlich ungewollt - zu der gegenteiligen, aber verständlichen Reaktion des
Schweigens bei Patienten führen. Damit wäre keinem der Beteiligten gedient. Zu der abschließenden
juristischen Einschätzung, ob die Diagnose einer HIV-Infektion - wie von mancher Seite durchaus
gefordert - nun auf einem Überweisungsschein durch den Behandler verpflichtend zu erfolgen hat und in
welcher Form dies geschehen sollte (ICD-Code oder ausgeschrieben), steht in Hessen die Stellungnahme der
Justitiare aus. Diese wird auch Patientenrechte berücksichtigen müssen.
Kommentar Dr. Heribert Knechten, Vorstand der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der HIV-Versorgung (DAGNÄ):
 Die
DAGNÄ stimmt dem Kollegen im notärztlichen Dienst ohne weiteres zu, dass beim Umgang mit Blut
und Blutprodukten äußerste Sorgfalt geboten sein muss. In allen medizinischen Einrichtungen
sind Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz aller Mitarbeiter Standard - insbesondere beim Umgang mit
potentiell infektiösen Materialen wie u.a. Blut. Die gewissenhafte Beachtung dieser Standards ist
ausreichend. Dies beinhaltet z.B. auch das Tragen von Handschuhen, welches - soweit der Fall aus Sicht der
Patientin bekannt ist - wohl nicht eingehalten wurde. Unterschiedliche Standards im Umgang mit Blut und Körperflüssigkeiten,
die potentiell infektiös sind, gibt es nicht. Zudem wurde sogar der vom weiter behandelnden Arzt
geforderten Mitteilung der HIV-Diagnose durch die ICD-Verschlüsselung "B24 G" Rechnung
getragen. Diese Art der Informationsmitteilung unter ärztlichen Kollegen ist üblich und völlig
adäquat. Die offene Ausweisung der Diagnose hätte bei Verlust des Überweisungsscheines
schwerwiegend Konsequenzen. Eine weitere Möglichkeit ist das Mitteilen der Diagnose durch den
Patienten selbst. Doch wie kann man angesichts der Erfahrung dieser Patientin, die leider kein Einzelfall
ist, HIV-Patienten dazu ermutigen, ihre Diagnose offen zu legen? Im Gegenteil, es muss allen klar sein,
dass solche Erfahrungen zum Schweigen der Patienten führen, denn nicht einmal die Weitergabe der
Diagnose in codierter Form ist ohne Zustimmung des Patienten möglich. Die DAGNÄ wird weiterhin
in enger Zusammenarbeit mit AIDS-Hilfen, AIDS-Aufklärung, Stadtgesundheitsämtern, den
Fortbildungsstellen der KV sowie der LÄK aktiv an dieser Problematik arbeiten. Ziel der Bemühungen
ist eine einheitliche, für alle Seiten zufrieden stellende, verbindliche Regelung.
Die
DAGNÄ stimmt dem Kollegen im notärztlichen Dienst ohne weiteres zu, dass beim Umgang mit Blut
und Blutprodukten äußerste Sorgfalt geboten sein muss. In allen medizinischen Einrichtungen
sind Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz aller Mitarbeiter Standard - insbesondere beim Umgang mit
potentiell infektiösen Materialen wie u.a. Blut. Die gewissenhafte Beachtung dieser Standards ist
ausreichend. Dies beinhaltet z.B. auch das Tragen von Handschuhen, welches - soweit der Fall aus Sicht der
Patientin bekannt ist - wohl nicht eingehalten wurde. Unterschiedliche Standards im Umgang mit Blut und Körperflüssigkeiten,
die potentiell infektiös sind, gibt es nicht. Zudem wurde sogar der vom weiter behandelnden Arzt
geforderten Mitteilung der HIV-Diagnose durch die ICD-Verschlüsselung "B24 G" Rechnung
getragen. Diese Art der Informationsmitteilung unter ärztlichen Kollegen ist üblich und völlig
adäquat. Die offene Ausweisung der Diagnose hätte bei Verlust des Überweisungsscheines
schwerwiegend Konsequenzen. Eine weitere Möglichkeit ist das Mitteilen der Diagnose durch den
Patienten selbst. Doch wie kann man angesichts der Erfahrung dieser Patientin, die leider kein Einzelfall
ist, HIV-Patienten dazu ermutigen, ihre Diagnose offen zu legen? Im Gegenteil, es muss allen klar sein,
dass solche Erfahrungen zum Schweigen der Patienten führen, denn nicht einmal die Weitergabe der
Diagnose in codierter Form ist ohne Zustimmung des Patienten möglich. Die DAGNÄ wird weiterhin
in enger Zusammenarbeit mit AIDS-Hilfen, AIDS-Aufklärung, Stadtgesundheitsämtern, den
Fortbildungsstellen der KV sowie der LÄK aktiv an dieser Problematik arbeiten. Ziel der Bemühungen
ist eine einheitliche, für alle Seiten zufrieden stellende, verbindliche Regelung.

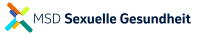







 Diese Seite weiter empfehlen
Diese Seite weiter empfehlen
