HCV-Addendum
Neue Leitlinie Hepatitis C

© Fotolia
Die DGVS hat ein Addendum zur Leitlinie „Hepatitis C“ veröffentlicht, das die Behandlung erleichtert. Ein sechsmonatiges Warten, um die Definition der chronischen Hepatitis C zu erfüllen, ist nicht mehr nötig, wenn die typische Konstellation einer chronischen Infektion vorliegt.
Deutschland soll auf dem politisch erklärten Willen zur Elimination der Hepatitis C nicht am Zulassungstext der antiviralen Medikamente scheitern, die lediglich zur Behandlung der chronischen Hepatitis C zugelassen sind. Die Definition der Chronifizierung durch den Nachweis von HCV-Ak bzw. einer positiven HCV-RNA über sechs Monate ist – so die Experten – nicht praktikabel und kann zudem den Therapiebeginn unnötig verzögern.
Indikation
Alle
Patienten mit einer replikativen HCV-Infektion (d.h. Nachweis von
HCV-RNA im Blut) sollten antiviral
behandelt werden und zwar auch
bei Erstdiagnose umgehend, wenn die typische Konstellation einer
chronischen Infektion vorliegt. Dies ist der Fall, wenn bei positiven
HCV-Ak und nachweisbarer HCV-RNA bzw. HCVcore-Antigen, klinisch und
laborchemisch keine akute (ikterische) Hepatitis und anamnestisch und
laborchemisch kein Risiko für eine
Übertragung des Virus bzw. keine Evidenz für eine Serokonversion in
den letzten 6 Monaten vorliegt. Erhöhte Transaminasen und/oder der
Nachweis einer Fibrose sind keine notwendigen Voraussetzungen für
eine antivirale Therapie. Bei einer fortgeschrittenen Fibrose bzw.
Zirrhose besteht eine dringliche Therapieindikation. Als weitere
unabhängige Indikationen zur Behandlung werden zudem extrahepatische
Manifestationen, berufliche Gründe, die Elimination des
Transmissionsrisikos, Ko-Infektionen mit HBV oder HIV sowie ein
Therapiewunsch des Patienten genannt.
Akute Hepatitis C
Bei der akuten bzw. kürzlich erworbenen HCV-Infektion (HCV-RNA positiv/HCV-Ak negativ oder HCV-Ak Serokonversion in den letzten sechs Monaten) liegt ebenfalls eine replikative HCV-Infektion und damit grundsätzlich auch eine Therapieindikation vor. In einzelnen Fällen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine spontane Elimination der kürzlich erworbenen HCV-Infektion und fehlendem hohen Risiko für eine weitere Übertragung des Virus (z.B. keine chirurgische Tätigkeit; kein unkontrollierter i.v. Drogenabusus) kann zunächst der Spontanverlauf abgewartet werden. Kommt es jedoch innerhalb von vier Wochen nicht zu einem Abfall der HCV-RNA über mindestens 2 log10 Stufen oder ist nach 12 Wochen noch HCV-RNA nachweisbar, kann man von einer Chronifizierung ausgehen.
Es wird aber auch explizit drauf hingewiesen, dass man auf die Therapie verzichten kann, wenn kein Transmissionsrisiko oder keine fortgeschrittene Lebererkrankung vorliegt sowie bei alten Patienten ohne Therapiewunsch.
Behandlung
Durch die Zulassung von pangenotypischen Regimen hat sich die Therapie der HCV-Infektion bei unkomplizierten Patienten weiterhin vereinfacht. Es besteht daher die Möglichkeit, die antivirale Therapie ohne Bestimmung des HCV-Genotyps durchzuführen. Bei Zirrhose bzw. vorbehandelten Patienten ist jedoch die HCV-Genotypisierung obligat. Patienten mit HIV- oder HBV-Koinfektion können wie HCV-Monoinfizierte behandelt werden. Die DAA-Therapie kann allerdings bei HBV/HCV-Koinfektion in sehr seltenen Fällen zur HBV-Reaktivierung führen.
Einfach zu behandeln
Einfach zu behandeln sind Patienten mit folgenden Kriterien
- Keine Vortherapie mit DAA-Kombination
- keine dekompensierte Zirrhose (Child B/C)
- Keine fortgeschrittene Niereninsuffizienz (GFR >30 ml/Min)
Pangenotypische Therapie
Die Therapieoptionen werden in „pangenotypisch“ und „Genotyp 1 und 4“ unterteilt.
Bei pangenotypischen Optionen wird Glecaprevir/Pibrentasvir oder Sofosbuvir/Velpatasvir empfohlen. Die Therapiedauer bei Sofosbuvir/Velpatasvir beträgt 12 Wochen. Bei Glecaprevir/Pibrentasvir beträgt die Therapiedauer 8 Wochen – mit Ausnahme von vorbehandelten Patienten mit GT3, die 16 Wochen behandelt werden sollten (Tab. 1).
| Therapieregime | Dauer (Wo.) | Pat. ohne Zirrhose | Pat. mit komp. Zirrhose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN1/TE2 | GT3+TE3 | TN1 | TE2 | GT3+TE3 | ||
| GPR + PBR | 8 | x | x | |
||
| GPR + PBR | 12 | x | |
|||
| GPR + PBR | 16 | x | x | |||
| VEL + SOF | 12 | x | x | x | x | x4 |
|
1 TN, therapie-naiv (ohne jegliche HCV-Vortherapie); 2 TE, therapie-erfahren (Vorbehandlung mit (PEG)-Interferon +/- RBV. Zusätzlich für die Therapie mit GPR + PBR auch Vorbehandlung mit Sofos-buvir in Kombination mit PEG-Interferon + Ribavirin oder Sofosbuvir + Ribavirin. Zusätzlich für die Therapie mit VEL + SOF auch Vorbehandlung mit Boceprevir, Telaprevir oder andere NS3-Protease-Inhibitoren in Kombination mit PEG-Interferon + Ribavirin); 3 GT3 + TE, Infektion mit dem HCV-Genotyp 3 und therapie-erfahren im Sinne einer Vorbehandlung mit (PEG)-Interferon +/- RBV, Sofosbuvir mit PEG-Interferon + Ribavirin oder Sofosbuvir + Ribavirin; 4 Bei Patienten mit einer HCV-Genotyp 3 Infektion und Leberzirrhose kann zu VEL + SOF zusätzlich Ribavirin gegeben werden. Ggf. kann das Ergebnis einer NS5A-Resistenzanalyse zur Festlegung der Gabe von Ribavirin hinzugezogen werden; |
||||||
Tab 1 Empfehlung zum Einsatz von pangenotypischen Therapieregimen bei DAA-naiven Patienten ohne dekompensierte Leberzirrhose und ohne fortgeschrittene Niereninsuffizienz
Genotyp 1 und 4
Einfach zu behandelnde Patienten mit einer Genotyp 1 oder 4 sollen unter Berücksichtigung des Vortherapiestatus, der Komedikation und ev. Komorbiditäten und ggf. viraler Resistenzen bei einem Einsatz von genotypspezifischen Therapieoptionen mit Grazoprevir plus Elbasvir für 12 oder 16 Wochen oder Ledipasvir plus Sofosbuvir für 8 oder 12 Wochen behandelt werden (Tab. 2).
| Therapieregime | Dauer (Wo.) | Pat. ohne Zirrhose | Pat. mit komp. Zirrhose | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TN1/TE2 | GT3+TE3 | TN1 | TE2 | ||
| GZR + EBR (Genotyp 1a) | 12 | x3 | x3 | x3 | x3 |
| GZR + EBR (Genotyp 1b/4) | 12 | x | x | x | x |
| LDV + SOF (Genotyp 1)8 | x4 | ||||
| LDV + SOF (Genotyp 1/4) | 12 | x | x | x5 | x5 |
1 TN, therapie-naiv (ohne jegliche HCV-Vortherapie); 2 TE, therapie-erfahren (Vorbehandlung mit (PEG)-Interferon alfa +/- RBV); Bei GZV/EBR kann bei Vorbehandlung mit Boceprevir, Telaprevir oder anderen NS3-Protease-Inhibitoren in Kombination mit PEG-Interferon + Ribavirin zusätzlich Ribavirin gegeben werden. 3 Bei Patienten mit einer HCV-Genotyp 1a Infektion und einer Ausgangs-Viruslast >800.000 IU/ml oder viralen Reistenzen im Bereich des NS5A-Gens (M/L28T/A, Q/R30E/H/R/G/K/L/D, L31 M/V/F, H58D, Y93C/H) sollte eine Therapieverlängerung auf 16 Wochen erfolgen und zusätzlich Ribavirin gegeben werden. 4 Für Patienten mit niedriger Ausgangsviruslast (<6 Millionen IU/ml), siehe auch Erläuterungen; 5 Bei negativen Prädiktoren, wie z.B. Versagen auf eine Vortherapie und / oder Thrombozytenzahlen <75.000/μl | |||||
Tab 2 Empfehlung zum Einsatz von Genotyp-spezifischen Therapieregimen für DAA-naive Patienten mit einer HCV-Genotyp-1 oder -4 Infektion ohne dekompensierte Leberzirrhose
Bei
Genotyp 1b wird Grazoprevir und Elbasvir über 12 Wochen empfohlen.
Eine Therapieverkürzung auf 8 Wochen wird aufgrund einer
eingeschränkten Datenlage und fehlender Zulassung nicht empfohlen.
Bei Genotyp 1a ist die Standardtherapie Grazoprevir plus Elbasvir
über 12 Wochen. Bei Patienten Genotyp 1a Infektion und einer
Baseline-Viruslast über 800.000 IU/ml und/oder NS5A-Resistenzen
sowie bei vortherapierten Genotyp 4 infizierten
Patienten sollte
zusätzlich Ribavirin gegeben und die Therapie auf 16 Wochen
verlängert bzw. alternative Therapie-regime ausgewählt werden.
Bei Genotyp 1 oder 4 wird Sofosbuvir und Ledipasvir über 12 Wochen empfohlen. Bei Patienten mit kompensierter Leberzirrhose sollten alternative Therapieoptionen evaluiert werden, bei denen keine Therapieverlängerung bzw. die Hinzunahme von Ribavirin notwendig ist. Bei der Ersttherapie von Patienten mit Genotyp 1 ohne Zirrhose mit einer Ausgangsviruslast <6 Millionen IU/ml sollte die Behandlung auf 8 Wochen verkürzt werden.
Dekompensierte Zirrhose
Die Behandlung von Patienten mit dekompensierter Leberzirrhose sollte in erfahrenen Zentren erfolgen. Grundsätzlich ist die Indikation/Möglichkeit zur Lebertransplantation zu prüfen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen scheinen die meisten Patienten mit einem niedrigen bis mittleren MELD-Wert von einer antiviralen Therapie mit anhaltender Verbesserung der Leberfunktion zu profitieren, während in der Mehrzahl der Patienten mit höheren MELD-Werten (typischerweise MELD >20) trotz Viruseradikation keine ausreichende klinische Verbesserung zu erwarten ist.
Bei
dekompensierter Leberzirrhose sollen unter Berücksichtigung des
Vortherapiestatus, der Komedikation und ev. Komorbiditäten
Velpatasvir plus Sofosbuvir +/- Ribavirin für 12 oder 24 Wochen oder
alternativ bei Genotyp 1 oder 4
Ledipasvir plus Sofosbuvir +/- Ribavirin über
12 oder 24 Wochen erhalten. Protease-Inhibitor
basierte Regime sind bei dekompensierter
Zirrhose nicht empfohlen.
Niereninsuffizienz
Bei schwerer Niereninsuffizienz (GFR <30 ml/min bzw. Dialyse) sollen unter Berücksichtigung des Vortherapiestatus, der Komedikation und ev. Komorbiditäten mit Glecaprevir plus Pibrentasvir für 8, 12 oder 16 Wochen oder alternativ bei Genotyp 1 oder 4 mit Grazoprevir plus Elbasvir für 12 oder 16 Wochen behandelt werden. Regime mit Sofosbuvir sollten bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz nicht eingesetzt werden. Bei der zusätzlichen Gabe von Ribavirin ist eine Dosisanpassung entsprechend der GFR notwendig.
Resistenztest
Resistenz-assoziierte Substitutionen (RAVs) gegenüber den verschiedenen DAAs beeinflussen die antivirale Aktivität der entsprechenden Substanz. Bei Ersttherapie konnte für die Mehrzahl der verfügbaren DAA-Kombinationstherapien keine relevante Bedeutung für das virologische Therapieansprechen nachgewiesen werden, weshalb in dieser Situation keine generelle Resistenzbestimmung empfohlen wird. Lediglich vor einer Behandlung mit Grazoprevir und Elbasvir für 12 Wochen soll bei Genotyp 1a und einer Viruslast von über 800.000 IU/ml eine NS5A-Resistenzanalyse erfolgen. Bei Patienten mit Genotyp 3 bzw. Vorliegen einer Zirrhose kann eine NS5A-Resistenzanalyse vor einer Therapie mit Velpatasvir plus Sofosbuvir oder Glecaprevir plus Pibrentasvir.
Bei Re-Therapie nach Versagen auf eine direkt antivirale Kombinationstherapie mit DAAs der ersten Generation kann eine Resistenzanalyse erfolgen. Nach einem Versagen auf Glecaprevir plus Pibrentasvir oder Voxilaprevir, Velpatasvir und Sofosbuvir sollte eine Resistenzanalyse durchgeführt werden.
Überwachung
Aufgrund der sehr guten Verträglichkeit der DAA-Therapien ist eine engmaschige Kontrolle zur rechtzeitigen Erfassung von klinischen Nebenwirkungen und Laborveränderungen in der Regel nicht notwendig. Bei einzelnen Therapieregimen wie z.B. der Gabe von Grazoprevir und Elbasvir wird die Überwachung der Transaminasen alle 4 Wochen unter Therapie empfohlen. Bei der Gabe von Ribavirin ist die Überwachung des Hämoglobinwertes notwendig.
Eine HCV-RNA-Messung kann unter Therapie erfolgen, um die Adhärenz und die Wirksamkeit der Behandlung zu überprüfen. Eine minimale Restvirämie im Verlauf unter Therapie und am Therapieende (<25 IU/ml) ist nicht mit einem Therapieversagen assoziiert und sollte daher nicht zu einem Therapieabbruch oder einer Therapieverlängerung führen. Ansonsten erfolgen die Kontrollen entsprechend der individuellen Charakteristika des Patienten.
Zur Bestimmung des abschließenden Therapieansprechens soll eine HCV-RNA Messung frühestens 12 Wochen nach Therapieende erfolgen. Weitere Kontrollen der HCV-RNA können im Verlauf erfolgen. Bei Patienten mit fortgeschrittener Fibrose und Zirrhose ist eine Überwachung im Hinblick auf Komplikationen einschließlich eines Leberzellkarzinoms angezeigt.

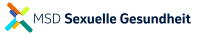







 Diese Seite weiter empfehlen
Diese Seite weiter empfehlen
